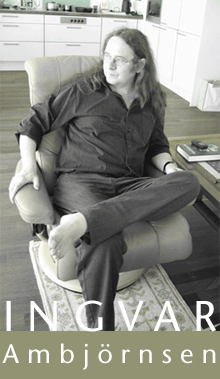

Rückkehr zu Tropo
Mein erster Cafébesuch wurde in vieler Hinsicht zu einem grundlegenden Erlebnis. Ich lernte dabei etwas über die Zukunft, über das Leben, das vor mir lag und gelebt werden sollte. Als ich mich dem Boden meines Limoglases näherte, war mir klar, dass mein Leben nicht so aussehen würde wie das meiner Eltern. Ich war sieben Jahre alt und bereit, der Welt ins Auge zu schauen. Es war der 17. Mai, also der Nationalfeiertag, und es regnete. In den sechziger Jahren regnete es in Larvik immer am 17. Mai. Vor allem vormittags. Wenn der Festzug der Kinder zu Ende war, klärte es sich dann meistens auf. Vormittags aber regnete es immer.
In diesem Jahr kaufte ich mir keinen Papierhut, keinen Gummiball und keinen Bambusstock, wie meine Altersgenossen das taten. Ich ging lieber ins Café. Allein. Ich verließ das Haus meiner Eltern, überquerte die Prinsegate und betrat die Konditorei Hagen. Ich hatte dort schon hundertmal Brot für meine Mutter gekauft, aber das hier war etwas anderes, es war meine freie Entscheidung, und es ging nicht mehr um Graubrot, o nein, nun waren die wahren Delikatessen angesagt. Ich setzte mich an einen Fenstertisch. Frau Hagen, die außer mir der einzige Mensch im Lokal war, starrte mich von der anderen Tresenseite her verwundert an. Es war neun Uhr. Sie hatte gerade den Laden geöffnet. Das Ambjørnsen-Kind saß stocksteif da und schaute den anderen Kindern zu, die auf der Straße spielten.
Ich wartete, bis Frau Hagen an meinen Tisch kam. Erst dann bestellte ich eine Tropo. Eine hervorragende Limonade, die leider von den Speisekarten verschwunden ist, selbst in den feinsten Lokalen. „Glaub mir, Tropo ist gut“, hieß es in der Werbung. Das werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Ich bestellte bei Frau Hagen, ohne sie anzusehen, eine große Tropo. Draußen wuselten meine Freunde herum und schlugen sich gegenseitig mit Bambusstöcken ins Gesicht. Espen hatte sich schon seine gute Jacke mit Eis bekleckert. Knut weinte.
Ich aber trank Tropo, erfrischende Schlucke. Auf der anderen Straßenseite lag mein Elternhaus. Meine Eltern standen im ersten Stock am Fenster und starrten mich an. Und mir ging auf, dass ein Elternhaus ein Ort ist, den man zu einem bestimmten Zeitpunkt verlässt. Das konnte ich meinen Eltern ansehen. Ich begriff, dass sie einfach nicht begreifen konnten, was ich da machte. Sie sahen es zwar. Sie sahen, dass ich Tropo trank. Aber sie begriffen nicht, warum ich das in der Konditorei Hagen machte, am 17. Mai, um 9 Uhr morgens. Sie standen nebeneinander und wunderten sich. Sie in Tracht, er im Anzug. Ich glaube, da und dort haben sie mich verloren. Und sie haben zumindest intuitiv verstanden, dass es Ärger geben würde. Ich hatte nichtsahnend gegen ein Gesetz verstoßen. Gegen das Gesetz „Du sollst nicht im Café Tropo trinken, wenn du ein Zuhause hast, wohin du gehen kannst.“
In allen späteren Jahren waren meine Eltern traurig, wenn sie sich auf ihrem Schwarz-Weiß-Fernseher englische Serien anschauten. Denn da saßen die Leute im Pub und tranken Bier. Männer und Frauen. Sie warfen mit Pfeilen und erzählten Witze, bei denen Mutter rot anlief. Meine Eltern schüttelten den Kopf. Sie begriffen nicht, warum die Engländer nicht zu Hause bleiben konnten.
Als ich alt genug war, um auf eigene Faust ins Ausland zu fahren, war England mein erstes Reiseziel. Ich hatte kein bisschen Heimweh. Auch nicht nach Tropo, obwohl das, wie gesagt, eine sehr gute Limonade war.
Sinn des Lebens im Kaffeehaus finden
Wir können uns natürlich fragen, was das alles mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Sehr viel, glaube ich. Schließlich habe ich mit sieben Jahren erkannt, dass der Sinn des Lebens im Kaffeehaus liegt. Oder im Gang ins Kaffeehaus, im Dasein im Kaffeehaus. Mein Schlüsselerlebnis am Nationalfeiertag hat mir den Sinn des Lebens eröffnet. Und ein wenig auch den Weg zur Literatur, das aber nur sehr nebenbei. Ich meine, wir gehen doch nicht ins Café, um Gedichte und Romane zu schreiben, sondern um uns volllaufen zu lassen und uns zu amüsieren. Ja, wir brauchen uns nicht einmal zu amüsieren. Natürlich kommt es vor, dass wir nach einem reeeeeecht langen Cafébesuch mit einer Serviette im Ohr aufwachen und dass auf dieser Serviette ein paar Buchstaben stehen. Eine Art Spontangedicht. Aber, um es ganz offen zu sagen, bei mir war nie etwas dabei, was eine Reinschrift gelohnt hätte. Wenn die Nacht zum bösen Morgen wird, verwandelt sich Genialität in Stupidität, so sieht jedenfalls meine Erfahrung aus. Einmal habe ich in meiner langen Unterhose einen Zettel gefunden. Ich wusste nicht einmal, in welcher Stadt ich war, und auf dem Zettel stand: „Ich hoffe, nächstes Mal wird’s ein bisschen gemütlicher. Gruß, Ellen.“
Klare Aussage, natürlich, aber wohl kaum große Literatur.
Ich halte die Kombination Literatur + Café für arg überschätzt. Vor allem, wenn es um die Dichter des 19. Jahrhunderts geht. Alle Gewährsleute sind längst tot, und da verselbstständigen die Gerüchte sich ja gern. Eine gute Geschichte lebt ihr eigenes Leben und wird gewissermaßen immer noch besser. Es ist durchaus nicht unvorstellbar, dass unsere Nachkommen, wenn sie uns also nachkommen, aufsehenerregende Berichte über Literaturtage der neunziger Jahre lesen werden. Lars Saabye Christensen hat in einer Kneipenecke einen ganzen Roman geschrieben, während der Verlagsbote geduldig am Tresen saß. Eine von Kjell Askildsens genialen Novellen wurde auf dem Klo oben im ersten Stock empfangen, und Vigdis Hjorth kotzte in ihren Schuh und kapierte nicht, dass sie sich auf die Herrentoilette verirrt hatte. Die seither natürlich unter Denkmalschutz steht.
Was wissen wir denn?
Ich meine, was wissen denn wir?
Die Dichter der sogenannten Christiania-Bohème haben sich im Kaffeehaus angeblich gegenseitig ihre Texte vorgelesen. Und Kritik geübt, natürlich. Krass und herzlos, wie es so ihre Art war. Damals hatte der Revolver noch seine natürliche Funktion im kulturellen Leben Norwegens, und man konnte literarisch unsterblich werden, indem man sich ganz einfach eine Kugel in die Kehle jagte, weil die Angebetete sich abweisend zeigte. Ein würdiger Abschlusspunkt, der einiges über die damalige Zeit, die Literatur und vor allem die Angebetete aussagt. Aber man machte das nicht einfach so. Zuerst drohte man damit. Und zwar oft. Im Café.
Ansonsten ist es ein Mythos, dass diese Bohemiens soviel geschrieben hätten. In Wirklichkeit haben sie verdammt wenig geschrieben. Vor allem, wenn wir von Hans Jæger absehen, und das mache ich gern. Ich glaube, Hans Jæger war so einer, wie wir ihn alle kennen. So ein Heini, der zerknüllte Zettel aus der Hosentasche zieht und mehr oder weniger syphilitische Gedichte vorträgt. So ein Heini, der allen die Stimmung verdirbt und der nicht kapiert, dass er einfach nur eine Motte ist, die jemand aus dem Fenster scheuchen sollte. Die Bohemiens fanden es toll, mittelmäßig zu sein. Und es stimmt auch nicht, dass sie sich im Kaffeehaus zusammenrotteten, um gegen die Kernfamilie zu opponieren. Die meisten von ihnen waren arme Bauernburschen, die das Schicksal in die Stadt verschlagen hatte. Sie wohnten in dermaßen zugigen Buden, dass sie den Kopf durch die Risse in der Wandtäfelung stecken konnten. Sie hatten keine Wahl. Für sie hieß es: Kaffeehaus oder Tod. Und dann entschieden sie sich natürlich für das Kaffeehaus, und einige auch für Kaffeehaus und Tod. Aber, wie gesagt: Viel geschrieben haben sie nicht. Weder im Kaffeehaus noch anderswo.
Schreiben ist eine intime Tätigkeit
Ich selbst bin oft ein wenig verlegen, wenn ich im Café Leute schreiben sehe. Das ist irgendwie zu viel des Guten. Schreiben ist doch eine intime Tätigkeit. Fast schon sexuell. Als ich zum ersten Mal versuchte, ein Gedicht zu Papier zu bringen, lief ich knallrot an. Dazu hatte ich natürlich auch allen Grund, wenn man mein Produkt bedenkt, aber trotzdem. So geht das einfach nicht. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute mir ihre Kinder zeigen, aber bei der Zeugung möchte ich lieber nicht dabei sein. Das macht mich verlegen, wie gesagt. Vor allem, wenn ich in einer Taverna in Griechenland einen Studenten aus den USA sehe. Mit einem dicken Notizbuch und einem Bleistift. Dann bin ich fast schon wütend. Die Vorstellung, in die Ferienbetrachtungen oder gar in die holprigen Gedichte eines amerikanischen Studenten einbezogen zu werden, macht mich einfach fertig.
Andererseits: Ich hätte es verdient. Das weiß ich. Und deshalb werde ich fast schon böse.
Und damit sind wir wieder bei Tropo angelangt. Bei Tropo, dem Sinn des Lebens und dem Fenstertisch. Spielende Kinder auf der Straße. Die eigenen Eltern, die wie Salzsäulen am Fenster stehen. Denn da und dort wurde ich zum Schriftsteller. In der Konditorei Hagen habe ich Sehen gelernt.
In bin diesem Fenstertisch treu geblieben. Eigentlich habe ich ihn nie wieder verlassen.
Und ihr seid die Kinder, die auf der Straße spielen.
Wartet nur!

